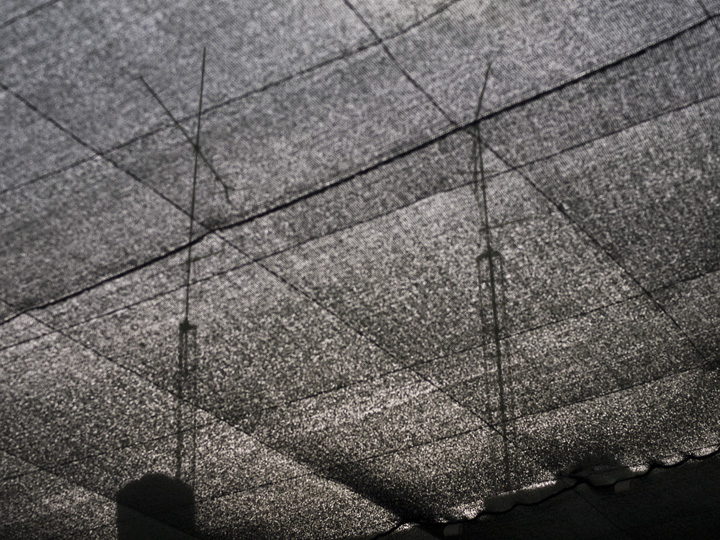Der erste volle Drehtag unter der heissen Sonne von Jenin. Ich sah heute viele verschlossene Türen, deren Eintritt mir als Kerl verwehrt wurde. Als Mann war ich an diesem Tag definitiv die unterdrückte Minderheit.

Die Fahrt nach Palästina ist jetzt schon über ein halbes Jahr her (und der letzte Blogeintrag dazu schon ganze 5 Monate), dennoch spüre ich wieder die Sonne und den feinen Sand auf der Haut, wenn ich mir die Bilder aus der Zeit anschaue.
Der erste volle Drehtag begann mit einem späten Frühstück. Ich holte die Kamera aus dem Keller des Cinema Jenin, wo sich hinter einer schweren Eisentür mit arabischen Muster viel gespendete Technik stapelte. Stets war jemand am Löten oder reparieren, um die vorhandene Ausrüstung noch in Schuss zu halten.
Wir schnappten uns die Übersetzerin und unseren treuen Taxifahrer Jamal, der uns am Tag zuvor in den Sonnenuntergang gefahren hat. Unser Ziel war das Flüchtlingslager von Jenin.
Etwas zu schnell für meinen Geschmack sauste der Fahrer die verwinkelten Straßen des Lagers entlang. Er kannte diese Straßen sehr gut, schließlich wohnte er selbst hier. Stolz fuhr er auch extra an seinem Haus vorbei: Eine Wohung in einem schattigen Hinterhof, gegossen in Beton. Er lächelte, als er auf die schmutzige Fassade blickte und meine Kollegin konnte nur ein gezwungenes „schön hier“ äußern, damit die Fahrt wieder weiterging.
Für unser Filmprojekt zum Thema „Frauen in Palästina“ wollten wir heute zunächst in einem Frauenzentrum im Lager drehen. Die Plakette am Eingang sagte, dass das Haus 2005 mit Hilfe der UNO und Kanada entstanden ist. Die starken Abnutzungserscheinungen am Gebäude ließen es jedoch viel älter wirken. Ein alter Spielplatz stand vor einer abbröckelnden Malerei von lachenden Kindern, und rostete langsam vor sich hin.
Das Frauenzentrum war gleichzeitig auch ein Kindergarten, Hort und Jugendzentrum. Die Frauen hier kümmern sich ehrenamtlich um die Kinder. Eine Gruppe von älteren Damen in Kopftuch beäugte uns skeptisch, als wir das Gebäude betraten. Aber vielleicht beäugten sie auch nur mich, da Männer hier selten gesehen sind.
Nach einem kurzen Gespräch mit der Direktorin wurden wir an den Kindergarten im Hause weitergeleitet. Mit einer der Erzieherin dort führten wir ein Interview. Ich blieb dabei im Hintergrund – und hatte somit mehr Zeit zum Fotografieren.
Die Kinder verfolgten ganz aufgeregt und mit großen Augen die drei blonden Menschen mit den nicht gerade kleinen Kameras. Ich hantierte dabei mit zwei Geräten, einmal der digitalen Spiegelreflex und dem analogen Apparat. Beim analogen Fotoapparat musste ich immer manuell scharf stellen, was den Kindern Gelegenheit gab, sich vor meine Linse zu verstecken. Zunächst war es nur ein Mädchen, das sich laut lachend vor meiner Kamera versteckte, doch bald machten alle mit und rannten kichernd durch den ganzen Raum. Meine Kolleginnen konzentrierten sich aufs Interview und bekamen den Trubel, den ich auslöste, nicht mit. Die andere Erzieherin hatte sichtlich Probleme, die Kinder wieder unter Kontrolle zu bekommen. Vorallem nicht, als sie aus dem Raum raus rannten, um vor meiner Kamera zu flüchten.
Aber ein paar Jungs gab es dann doch, die sich vor die Linse trauten.
Als ich ihm das Bild zeigte, fand er es sehr witzig und dann wollten auch alle mal ins Bild.
Einer der Jungs drückte mir dann noch etwas in die Hand als wir gingen. Es waren Plastikteile, so zusammengesteckt, dass sie die Form einer Pistole ergeben. Kinder in Deutschland machen so etwas sicher auch, doch hier in einem Flüchtlingslager in Palästina, wo es regelmäßige gewaltsame Auseinandersetzungen gibt, fand ich es doch befremdlich. Ohne zu lächeln sagte ich Danke und gab es ihm zurück.
Mit der Direktorin gingen wir durch den Rest des Gebäudes. Im zweiten Stock gab es eine Art Sportraum, mit ausgefranzten Matten, einer Tischtennisplatte ohne Netz und Spiegeln an der Wand. In der Ecke kabbelten sich zwei ältere Jungs, während jüngere Jugendliche daneben standen. Resolut löste die Direktorin den Streit der Beiden auf. Zu viel Energie und ein Mangel an Angeboten sorgt eben dafür, dass sie sich aneinander abreagieren.
Im nächsten Raum, der komplett rosa gestrichen war, standen ca. 20 Frauen laut schnatternd herum. Es war eine Art Beauty-Salon, der gleichzeitig zur Ausbildung dienen sollte. Frauen bilden Frauen aus. Make-Up, Haare und Kopftuch-Kosmetik.
Auch wenn die Frauen meiner Ansicht nach nichts dagegen hatten, bestand die Direktorin darauf, dass ich vor dem rosa Zimmer bleibe. Die Tür blieb offen, doch ich durfte nicht herein.
So konnte ich nur von draußen sehen, wie meine Kolleginnen Interviews mit den Frauen machten. Ich fotografierte immer mal wieder rein, bis die Direktorin kam und mir mit einer entschuldigenden Geste die Tür vor der Nase zuknallte.
Da stand ich nun. Ich versuchte noch durch das Fenster über der Tür ein paar Bilder zu machen. Einige der Frauen bekamen das mit, versteckten ihr Lachen hinter ihren Händen und winkten vergnügt. Ein strenger Blick der Direktorin reicht dann aber, damit sie und ich damit aufhörten. Ich sah mich um.
Die Jungs kamen inzwischen neugierig aus dem Sportraum und sahen, dass ich alleine war. Sie zerrten mich in den Sportraum und der älteste von ihnen drückte mir eine Hantel in die Hand. Allein in einen Raum mit Jugendlichen, die zu viel Energie haben und anscheinend hier noch trainieren, machte mich dann doch etwas unsicher. Ich versuchte mich mit einem Lächeln durch die Tür zu stehlen, doch sie wurde mir von vielen kleinen Händen zugehalten. Irgendwie kam ich dann doch noch raus.
Neben dem rosa Zimmer mit den vielen kichernden Frauen, war die „Bibliothek“ des Zentrums. Gespendete Bücher auf schiefen Regalen, viele davon in Englisch. Durchs vergitterte Fenster sah ich ein Minarett und hörte das geschäftige Treiben der Straße.
Die Jungs waren immer noch umtriebig und fanden mich dann hier. Sie konnten kaum Englisch, dennoch fragen sie, ob meine beiden Begleiterinnen meine Frauen seien, ich verheiratet oder verliebt bin. Sie deuten nur an, ohne Sprache nur mit Gesten.
Begeistert darüber, dass ich Englisch kann, drücken sie mir ein Buch in die Hand, was sie blind aus dem Regal gezogen haben. Es ist ein amerikanisches Buch über Demokratie. Sie schlagen eine Seite mit Ronald Reagan und der Wirtschaftspolitik der 80er Jahre auf und bitten mich, es vorzulesen.
Nach zwei Sätzen stoppe ich und spare mit weitere wirtschaftliches Blah Blah. Sie zeigen derweil auf eine halbkaputte Tafel und sagen fehlerfrei eines der wenigen englischen Worte, das sie kennen: „Money?“
Sie wiederholen es häufig und halten die Hände auf. Wahrscheinlich sind sie es gewohnt, dass die einzigen Ausländer, die herkommen, auch Geld da lassen.
Ich winke ab und biete stattdessen an, mit den Jungs Armdrücken zu machen. Das nehmen sie auch viel lieber an. Zwei Jungs packe ich, aber der Älteste gewinnt. Er feiert seinen Triumph über mich, in dem er auf dem Tisch einen Handstand macht.
Siegreich verlässt er mit den anderen die Bibliothek und meine Kollegin kommt herein. Da sich die Dritte in unserem Team noch das Kopftuch von zehn Frauen machen lässt, wollen wir erstmal raus. Sie will rauchen, ich nicht, trotzdem komme ich gerne mit.
Unten ist eine Schar von Kindern, die alle neugierig auf uns zukommen. Alle wollen sie reden und plappern durcheinander, auch wenn wir kaum auf jeden reagieren können. Unsere Kollegin kommt sichtlich bewegt aus dem Gebäude raus. Mit einem wunderbar gesteckten Kopftuch setzt sie sich zu uns. Sie ist noch dabei zu verarbeiten, welchen Aufwand grad eine Schar von Frauen für sie als Fremde betrieben haben, da sind wir schon auf dem Weg zur Direktorin, um uns zu verabschieden. Sie stimmte nun doch zu, ein Interview mit uns zu machen. Es wird süßer Tee serviert und ich ziehe mich wieder in die andere Ecke des Raums zurück, da es wohl besser sei, wenn eine Frau die Fragen stellt und nicht ich als Kerl, sagt meine Kollegin.
Nach dem Ende des Interviews holt sie zwei Tüten hervor und breitet deren Inhalte auf dem Tisch aus.
Von zwei Frauen gefilmt zu werden war vorher kein Problem, doch als ich meine Kamera rausholte, versteckte sie ihr Gesicht. Sie präsentierte uns gestrickte und gehäkelte Waren, Geldbörsen und Taschen, Decken und Bezüge. Alle von den Frauen hier gemacht und mit traditionellen Mustern bestickt.
Mich überraschte, wie angenehm weich die Materialien waren. Meine Frage nach dem Stoff erbrachte keine Antwort. Schafswolle war es nicht, Kamelhaar aber auch nicht.
Da ich seit unserer Ankunft im arabischen Raum mein Geld immer nur in meine hintere Gesäßtasche stopfte, wo – seien wir mal ehrlich – neben meinem Gesäß nicht viel mehr Platz ist, war ich froh, eine geschmackvolle Alternative zu meiner Arsch-Tasche gefunden zu haben. Ich entschied mich und bezahlte den recht hohen Preis von umgerechnet 7€. Mehr hatte ich in der lokalen Währung auch nicht dabei, sodass ich zwar nun eine Geldbörse, aber keinen Inhalt dafür hatte.
Meine Kolleginnen deckten sich reichlich ein und wir bekamen jeder noch eine kleine Tasche obendrauf geschenkt. Einpacken und tragen durfte dann wieder ich als Kerl, da die anderen keine große Tasche dabei hatten.
Zum Abschied reichten wir uns die Hände. Nur meine ausgestreckte Hand blieb von der Direktorin unberührt. Stattdessen legte sie sich die Hand aufs Herz und schaute auf den Boden. Eine Geste, die Respekt bedeuten soll, mich aber mit meiner ausgestreckten Hand verwundert zurück ließ.
Zu Fuß machten wir uns auf dem Weg aus dem Lager und zurück in die Stadt. Wir kamen vorbei an bunt bemalten Wänden. Sie sind der Versuch, dem Grau des Lagers und der Situation etwas Schönheit zu geben.
Wir trafen auch auf viele Plakate und Poster mit oft grimmig blickenden Köpfen. Es waren Portraits von Märtyrern, die hier noch eine Verehrung finden. Doch fast alle Fotos verblassen bereits. Ihre Bedeutung schwindet.
Wieder erstaunte mich, wie sicher sich meine Kolleginnen durch das Flüchtlingslager bewegten, welches von einigen deutschen Medien auch als „Terroristen-Zentrum“ bezeichnet wird. In einem Rollkoffer zog ich unsere Ausrüstung hinter mir her, während viele Menschen auf uns zukamen und uns mit einem Lächeln das Bisschen verkaufen wollten, was sie haben. Ich versuchte, mich immer mit dem Koffer im Hintergrund zu halten, doch die Mädels hatten kein Problem mit der Direktheit der Leute.
Mädchenaugen hinter Stacheldraht verfolgten uns. Eine Schule nur für Mädchen befand sich hinter dicken Mauern auf der linken Seite der Straße. Ich winkte den jungen Damen am Fenster zu und sie fingen an zu feixen. Es wurden immer mehr Mädchen mit Kopftuch, die sich an den Fenster aufstellten und vergnügt zu dem komischen Blonden mit Rollkoffer auf der anderen Seiten der Straße winkten.
Wir betraten ein Einkaufszentrum an deren Eingang ein Schild mit einer durchgestrichen AK-47 hing. Einige, aber nicht viele Geschäfte sammelten sich hier, die meisten für Mode. Einem Tipp folgend suchten wir eine weibliche Ladenbesitzerin, die hier im zweiten Stock ein Geschäft für Damenmode hatte. Ich durfte zwar diesmal rein, doch es sei wohl besser „wenn eine Frau die Fragen stellt“, um einmal meine Kollegin zu zitieren.
Ein paar Jahre hatte sie schon den Laden. Sie sprach gutes Englisch, muss sie doch viel reisen, um ihre Kleidung im Ausland zu kaufen. Frauen kaufen bei Frauen ein, Männern bei Männern, sagt sie. Von daher ist es in Palästina nicht ungewöhnlich, dass Frauen ihr eigenes Geschäft aufmachen. Ihr Mann war zwar zunächst dagegen und hatte großes Skepsis was ihren Erfolg angeht, doch sie hatte, im Gegensatz zu ihm, mit ihren Geschäft langfristig Erfolg gehabt.
Nach dem Interview kam eine Kundin rein, eine Freundin von der Besitzerin. Sie hatte ein Kind dabei und die Ladenbesitzerin fing an zu erzählen. Der Mann ihrer Freundin ist seit 25 Jahren im Gefängnis, hat sein Kind das letzte Mal vor 8 Jahren gesehen. Die Ladenbesitzerin holte dann noch selbstgestickte Wandteppiche heraus, verziert mit traditionellen Mustern, aber auch mit Männern mit Kalashnikow in der Hand. Sie hält einen Stoff mit einer Karte vom Westjordanland vor sich und fängt an zu singen. Worum es ging, weiss ich nicht. Vielleicht was nationalistisches, etwas für den Widerstand oder ähnliche Inhalte zum kollektiven Mutmachen in einer schwierigen Situation. Wie man das bewerten sollte, das weiss ich nicht. Vielleicht ist das auch eine Art der Tradition in Palästina. Der Unterschied zwischen einer gestrickten Kalashnikow und einer gestrickten Geldbörse ist da vielleicht nur das Alter und nicht die Ideologie.

Im Rest vom Einkaufszentrum filmte ich dann mal zu Abwechslung. Nach drei Einstellung, die es am Ende nicht mal in den Film schafften, musste ich die Kamera wieder abgeben.
Wir machten uns auf den Weg zurück zum Gasthaus. Dabei kamen wir an einem Laden für Damenunterwäsche vorbei. Meine Kolleginnen bekamen gleich große Augen in der Hoffnung auf ein interessantes Gespräch, also fragten wir die Besitzerin nach einem Interview. Nach langen Reden stimmte sie zu. Fragen ja, Filmen nein, und Jungs schon mal gar nicht. Also musste ich wieder raus.
Da saß ich dann, vor einem Damenunterwäscheladen im Nahen Osten, und schob mit meinen ehemals weißen Schuhen den Staub auf dem Boden vor mir her.
Im Kopf spulte ich unser Material zurück. Ich war der Meinung, wir hätten schon zu viel, doch selbst nach dem Interview waren die Mädels nicht zu bremsen und wollten noch mehr filmen. Mir reichte es aber für den heutigen Tag. Wenn ich noch mal irgendwo draußen warten sollte, konnte ich das wenigstens auf dem Dach in der Hängematte tun.
Die Kopfhörer in meinen Ohren spielten gerade eine Symphonie, als ich sie abnahm um einer anderen Symphonie zu lauschen: Die Minarette der Umgebung spielten alle das gleiche Lied. Über den Trubel der Stadt wurden zum Sonnenuntergang Aufrufe zum Gebet in einem arabischen Sing-Sang gelegt, der hier im Tal alles andere übertönte. Nach zehn Minuten war es vorbei und die Stadt schrie wieder auf. Ich auf meinen Dach hatte jedoch endlich Ruhe…
…bis dann unser Übersetzer mit einer Bitte kam: Die Theatergruppe brauche wohl eben mal einen Betreuer, er hat aber keine Zeit, weil er gerade schneiden muss. Meine Frage, warum denn ich gerade dafür geeignet bin, quittierte er mit einem „ich habe schon drei andere vor dir gefragt.“ Grummelnd macht ich mich auf dem Weg zum Theater.
Ich wurde als „Experte für die Bühne vorgestellt“ während mir die palästinensischen Schauspieler ihre Idee erzählten. Die funktionierte eigentlich auch ohne mich, und wahrscheinlich wollten sie einfach nur jemanden haben, der es kontinuierlich abnickte. Mit einer deutschen Kollegin, die wohl ebenfalls eine „Bühnen-Expertin“ war, gestikulierte ich laut auf Deutsch, um zumindest den Anschein eines kompetenten Fachgesprächs zu erwecken. Als sich dann alles von der Bühne in den Garten verlagerte, schlich ich mich in der Dunkelheit davon. Schließlich war ich ja Experte für die Bühne, nicht für den Garten…
Zurück im Gasthaus hörte man überall kleine Küken, die für ihre Größe erstaunlich laut sein können. In einer Ecke stand dann ein Mülleimer, der zu einem Hühnerkäfig umfunktioniert wurde.
Das Kino, zu dem das Gasthaus gehörte, finanziert sich u.a. damit, Videobeiträge als Auftragsarbeit zu produzieren. So weit wie ich es verstanden habe, sollen die Küken in einem Werbespot Verwendung finden.
Mit meiner Kamera hatten sie schonmal keine Probleme. Hier kann man Küken halt noch auf dem Markt kaufen. So gabs dann neben einem kleinen Hundebaby auch noch flauschige Küken im Gasthaus – sehr zur Verzückung meiner weiblichen Kollegen.
Wieder in der Hängematte hatte ich nun den Sternenhimmel über mir. Es war zwar nur 18 Uhr doch die Stadt verstummte bereits. So konnte ich auch ein entferntes „Kannst ruhig zu mir kommen, wenn du magst“ hören, über das ich erstmal 15min nachdenken musste, bevor ich es deuten mochte. Auf dem Dach war es stockfinster und ich konnte nicht eindeutig sagen, woher der Ruf nun kam.
Im Dunkeln lag dann ein Mädchen. Im leichten Mondlicht erkannte ich noch, dass hier eine aus meiner Redaktion aus Berlin döste, und ich legte mich zu ihr. Während sie dann meinen Rücken massierte, schaute ich mir den hellen Mond an, der hier noch größer erschien als in Berlin. Doch ist der Mond genau so schwer zu erreichen wie für viele hier die andere Seite der Grenze.
Wir kümmerten uns dann darum, unser Material in den Rechner einzulesen. Der Cutter gab uns sein Daumen hoch und bestätigte auch meine Vermtung, dass wir genug Material haben. Der Schnitt sollte morgen folgen. Für uns endete mit dieser Ansage ein langer Tag. Gegen 2 Uhr Nachts waren aber in unserem Achtbettzimmer nur drei Kopfkissen belegt. Der Rest hing über den Computern und am Schnitt. Ich hingegen war im Schlafraum der Jungs.
Hier hatten die Mädels keinen Zutritt. Zum ersten Mal heute.
———
Post aus Nah-Ost:
Teil 1 – Die Straße nach Palästina
Teil 2 – Wie Tag und Nacht
Teil 3 – Der Tag der kaputten Kameras
Teil 4 – Männer müssen draußen bleiben