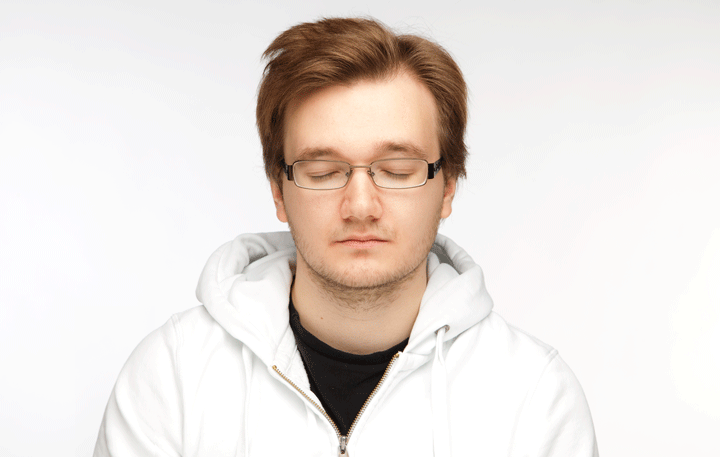Im Sommer war ich mit einer Gruppe von freiwilligen Helfern in Minami-Soma, einem Ort in der Präfektur Fukushima – 40km vom Reaktor entfernt. Ein Teil des Ortes liegt im 20km Bannkreis rund um das havarierte Kraftwerk, die Mehrheit der Bevölkerung hat die Stadt bereits verlassen. Kontaminierter Reis und radioaktiv belastetes Gemüse sind hier ihr größtes Problem.Fortsetzung von Teil 1

Der Geruch von dem verbrannten Gummi zog langsam in die Fahrerkabine unseres Laster. Links und Rechts waren nur Wälder und an diesem Morgen verirrten sich nur wenige Autos in die Berge von Fukushima. Wir stoppten also, um die Quelle zu finden.
Die Strecke durch die Berge war bewusst so gewählt, dass wir einen großen Bogen um den Reaktor machen. Doch das ewige Auf und Ab unserer tonnenschweren Ladung machte sich nun bemerkbar. Die Bremsen qualmten.
Zigarettenpause.

Es war nicht die erste Panne auf dieser Fahrt. Die ersten 50km sind wir mit offener Ladetür gefahren, bis uns dann ein freundlicher Fahrer auf dem Freeway anhupte und auf die Tür zeigte. Wir stoppten dann auf der Autobahn, ich hüpfte raus und zog die Tür zu. Zum Glück war noch alles drin. Bei der nächsten scharfen Kurve wären die Zwiebeln auf den Schnellstraßen von Tokyo gelandet.
Der Flughafen von Fukushima war von unserem Stopp nicht weit entfernt, aber dorthin umdrehen wollten wir nicht.

Wir quälten den Laster also wieder den Berg hinauf.

Bei jeder Talfahrt heulten die Bremsen auf. Ich schaute etwas skeptisch zu unserem Fahrer, doch der grinste nur durch seine Sonnenbrille auf die Fahrbahn. Fukushima Rollercoaster ohne Bremsen.

Wir zogen vorbei an alten Bergdörfern, malerischen Landschaften und Schluchten. Das Zirpen der Zikaden in den Wäldern war lauter als die Musik bei uns drinnen.
„Schön hier“, sagte ich in die Kabine. „Hier haben wir das letzte Mal die höchste Radioaktivität gemessen“, war die trockene Antwort. Ich machte mein Fenster wieder zu.

Am Ortseingang vom Minami-Soma standen Sonnenblumen, die ihren Höhepunkt schon überschritten hatten. Keiner kümmerte sich mehr um sie und sie gingen nun ein in der heissen Morgensonne. Der Eindruck von Vereinsamung zog sich noch ein wenig durch den Ort. Einige Geschäfte waren zu, manche Häuser leer und offen. Reisfelder am Wegesrand verwilderten. Wer weg konnte, ist weg.
Wir fuhren zunächst zum Bahnhof, wo wir auf örtliche Freiwillige treffen sollten, um mit ihnen den Tag zu planen.

Der Bahnhof war leer. Es fährt kein Zug mehr durch Minami-Soma, die Gleise sind dicht. Nur noch ein einzelner Angestellter saß in seiner Kabine im Bahnhof und guckte uns irritiert an. Auch wenn kein Zug mehr fährt, er sitzt da noch pflichtbewusst. Bis zum Schluss.

Das linke Gleis führt Richtung Reaktor und wurde seit März nicht mehr befahren. Mittlerweile wird es deutlich sichtbar vom Gestrüpp überwuchert.
Vom Bahnübergang soll man sogar Fukushima-Daiichi sehen können, sagte man mir, doch so sehr ich auch die Augen zusammenkniff, ich konnte das Kraftwerk nicht entdecken.
Minami-Soma machte den Eindruck einer lebendigen Kleinstadt. Menschen waren unterwegs, der Supermarkt gut besucht. Doch hier und da gab es Anzeichen dafür, dass nicht mehr so alles ist wie früher.


Vor dem Bahnhof stand eine große Karte von Minami-Soma und Umgebung. Als ich mich davor stellte, fing eine blecherne Stimme an aus der Uhr zu mir zu sprechen. Eine Begrüßung für Touristen, ausgelöst durch einen Bewegungssensor vor der Karte. So viele Reisenden werden nun nicht mehr nach Fukushima kommen und der Begrüßungstext spricht nur noch zu Minami-Somas Leere.
Es machte sich nun langsam bemerkbar, dass wir die Nacht durchgefahren sind und nicht geschlafen haben. Ich gönnte mir eine leicht radioaktive Cola aus dem Automaten am Bahnhof.

Radioaktive Cola. Refreshing & Uplifting.

Es trafen nun auch die ersten Freiwilligen ein. Angeführt von einem etwas kauzigen Kerl mit Sonnenbrille und Sonnenhut, der seine Hose zum Trocknen auf seine Kühlerhaube gelegt hatte. Eine Gruppe von älteren Dame wurde dann noch unterstützt von jüngeren Herren, alle mit den schwarzen Hemden ihres Sportvereins.
Der Leiter unserer Gruppe, mittlerweile im dritten T-Shirt seit Beginn der Reis, setzte mit amerikanischen Akzent zur Rede an um auf den Tag einzustimmen.


Sein Japanisch geriet jedoch bald an seine Grenzen, sodass er die Details dann lieber durch andere vermitteln ließ. Der Plan war wie folgt: Heute würden wir an drei verschiedenen Orten, wo Flüchtlinge aus Fukushima oder der Tsunami-Region untergekommen sind, Essen verteilen. Für Kinder gibt es zusätzlich noch Süßigkeiten-Pakete und Spielzeug. Über die Bereitschaft der Weissen aus dem Westen war man sichtlich gerührt.

Die erste und zweite Verteilungsaktion fanden in den provisorischen Lagern von Minami-Soma statt: Die Aluminium-Barracken, die die Regierung für Leute aufgestellt hat, deren Haus im 20km Bannkreis um den Reaktor steht oder die ihr Zuhause im Tsunami verloren haben. Ein paar hundert Personen leben jeweils in diesen Lagern.


Graues Aluminium auf grauen Kies und nichts, was in der Hitze dieser Mittagssonne Schatten bietet.

Radioaktiver Kiesel

Wir stellten die Trucks nebeneinander und bauten um die Ladeflächen eine Verteilungsstation auf.


Die Bewohner des Lagers stellten sich schon in einer Reihe auf und warteten darauf, dass die angekündigte Verteilung beginnt.




Die Frauen blieben am Wagen und verteilten an ihren Stationen die zugeteilten Mengen. Pro Person und Haushalt gab es eine bestimmte Anzahl Kartoffeln, Wasserflaschen und Früchten, die verteilt wurden. Wir Männer waren eingeteilt, immer wieder die Ladefläche mit Lebensmitteln aus dem hinteren Teil des Trucks zu befüllen und um den älteren Personen dabei zu helfen, ihre Lebensmittel nachhause zu kriegen. Denn die Güter waren reichlich, die Tüten und Kisten schwer und die, die hier wohnten, oft jenseits der 60.

Meine Aufgabe war es, meine Hilfe beim Tragen anzubieten. Das bedurfte oft einiger Überzeugungskraft. Denn auch wenn die Dame über 80 war und sich mit einem Buckel zum Laster quälte, die Höflichkeit macht es ihnen dann doch schwer, neben dem kostenlosen Essen auch noch um Hilfe beim Tragen zu bitten. Man entschuldigte sich öfter, als sich zu bedanken.
Ich nahm mir dann meine Kollegen zum Vorbild, die einfach beherzt nach den Tüten griffen und vor den Damen vorweg liefen. Da war kein Platz mehr für Diskussionen.
Mit meinem sporadischen Japanisch unterhielt ich mich etwas mit den Personen, denen ich beim Tragen half. Standard-Frage war natürlich: Wo kommst du her? Viele dachten, dass wir alle, wie der Leiter, aus Amerika stammten. Eine entgegneten mir auf meine deutsche Herkunft auch: jaja, die deutsch-japanische Freundschaft, wir helfen uns immer aus, nicht wahr? Wie die deutschen Medien Japan nach Fukushima geholfen haben, verschwieg ich.
Beim Abliefern konnte ich manchmal einen Blick in die Wohnungen in den Barracken riskieren. In ihrer Gleichheit erinnerten sie mich an Baukästen. Kasten an Kasten gab es immer das gleiche Layout in den nummerierten Blöcken. Grob imitierten sie den Schnitt einer japanischen Wohnung. Holz und Reismatten wurden jedoch gegen Stahl und Plastik ausgetauscht.
Man warnte mich, nicht zu persönlich zu werden. Ich sollte keine Fotos von Personen vor ihren Barracken machen, weil es ihnen oft peinlich sei, hier zu hausen. Alkoholmissbrauch und Suizidraten seien hoch unter den Bewohnern, sagte man mir, und ich gab mir Mühe, keine intimen Fragen zu stellen. Die wenigen persönlichen Fragen, die ich hatte, gingen oft ins Leere und wurden nur mit einem höflichen Lächeln beantwortet – wenn überhaupt.
Eines dieser Lager war direkt neben einem Reisfeld gebaut, das aus einem Bilderbuch stammen konnte. Die Trostlosigkeit der farblosen Aluminium-Baracken war geradezu in einem zynischen Kontrast zu dem saftigen Grün des Feldes, neben dem sie standen. Doch das saftige Grün ist trügerisch. Das dieser Reis radioaktiv belastet ist, ist klar. Das Risiko des Verzehrs und der Verarbeitung sollte man lieber nicht eingehen. So bleibt den Leuten nur auf den Reis zu starren, den sie nicht essen dürfen.

Nach den ersten zwei Verteilungsaktionen war ich bereits fertig. Die knallende Sonne, die hohe Luftfeuchtigkeit von über 90% und die Anstrengung nach einer Nacht ohne Schlaf gingen nicht ohne Spuren an mir vorbei. Einer der Helfer sah mich nur an und meinte zynisch „Ihr Medien-Leute seid keine harte Arbeit gewöhnt.“. „Ja“, keuchte ich, „wir schreiben nur drüber“.

Knie der Kompetenz II

Die letzte Aktion des Tages war in einem grauen Neubau. Hier lebten auch Familien, die ihr Zuhause seit März verloren hatten. Ähnlich wie in den Barracken war es unsere Aufgaben, die Essens-Kiste in die Wohnungen zu tragen. Vier Häuser mit je sechs Stockwerken. Ohne Aufzug.

Meine Arme zitterten, meine Hände verloren ständig den Halt an den Kisten. Alleine schaffte ich keine Kiste mehr nach oben, ich brauchte immer Hilfe oder kleinere Kisten. Oben angekommen sah man mir meine Erschöpfung dann stets an. Ob man denn etwas für mich tun könnte, fragte man. Ja, stöhnte ich, etwas zu trinken wäre nett. In der Hoffnung, einfaches Leitungswasser zu bekommen, schwitzte ich leicht gebeugt vor dem Apparment. Eine Mutter kam heraus und drückte mir zwei Dosen Kaffee und zweimal Gemüsesaft in die Hand. Beides wollte ich eigentlich nicht, aber ihre Höflichkeit ablehnen auch nicht. Aus ihrer Sicht hätte es so ausgesehen: Da kommt ein Blonder den ganzen Weg aus Deutschland um uns Kisten mit Kartoffeln und Zwiebeln in den fünften Stock zu schleppen, und dann nimmt er nicht mal unsere Dankbarkeit an.
Diese Menschen haben alles verloren. Besitz, Haus und womöglich auch noch Freunde und Verwandte. Trotzdem wahren sie noch ihre Höflichkeit und ihr Gesicht. Vielleicht gerade weil sie nicht mehr viel haben als das. Wer bin ich dann, ihnen das zu nehmen?
Ich nahm den Kaffee und den Saft und verteilte ihn an meine Kollegen. Mein Körper fiel ins Gras. Mehr ging nicht mehr.
Mehr musste zum Glück auch nicht mehr, denn die letzte Kiste ging gerade raus.
Die Arbeit war getan, das Essen für heute verteilt. Wir waren zu erschöpft, um über das Schicksal der Leute morgen nachzudenken. Für heute hatten ein paar hundert Personen frische Zwiebeln und Kartoffeln ohne radioaktiven Belag. Das sollte uns erstmal reichen.
Der Leiter erinnerte mich dann wieder daran, dass wir tatsächlich noch in Fukushima waren: „I’d like to run a Geiger counter on your ass, Fritz“. Erst dachte ich, dass er mich anmachen wollte. Und als ihm bewusst war, wie die Botschaft ankam, fing er auch mit den anderen an zu lachen. Doch schnell wurde er wieder ernst und ermahnte mich, dass der Boden hier sicherlich erhöhte Radioaktivität aufweist. Das Lachen verstummte und der Moment der Heiterkeit verschwand so schnell wie er kam. Ich stand auf, wischte mir die radioaktiven Grashalme vom Gesäß und fragte ihn, wie es jetzt weitergeht.
Er plädierte dafür, so schnell wie möglich nach Tokyo zurückzufahren. Doch die örtlichen Aktivisten luden uns noch zum Essen ein. Mit seiner Gegenstimme wurde der Vorschlag angenommen.

Wir fuhren zu einem herschaftlichen Anwesen. Traditionell japanisch und ungewöhnlich groß für ein Haus mitten in der Stadt. Die Damen vom Vormittag hatten kräftiges Beef-Curry zubereitet und wir langten alle zu. Mein Gesicht war inzwischen so rot wie das Curry. Dort, wo ich mir ein Handtuch um den Kopf gebunden hatte, zeichnete sich ein deutlicher Rand vom Sonnenbrand ab. Als dann das Vanille-Eis zum Dessert gereicht wurde hatte jeder in der Runde mal über meine Stirn gelacht. Diese Spur von Fukushima sah man nach meiner Rückkehr in Berlin noch.
Der Leiter und die zwei Fahrer lagen auf der Veranda und dösten weg. Im mittlerweile fünften Shirt seit Tokyo lag der Amerikaner auf dem lackierten Holz und hatte alle Viere von sich gestreckt. Ich war immernoch im selben Hemd unterwegs, dass ich nach dem Aufstehen in Shibuya angezogen hatte. Inzwischen war das über 25 Stunden her.
Noch ein Gruppenfoto und das Versprechen bald wieder zu kommen, und schon ging es heim.
Es sollte geradewegs Richtung Tokyo gehen wäre da nicht… wäre da nicht ich gewesen, der darauf bestand auch mal das Tsunami-Gebiet zu sehen. Ein kleiner Umweg an der Küste entlang hätte unsere mittlerweile leeren Trucks dorthin geführt. Unser Fahrer war inzwischen zu müde, um mit mir darüber zu diskutieren. Er reichte mir das Handy und meinte nur erschöpft, dass ich das mit dem Leiter klären sollte. Ich unterbreitete meinen Wunsch und der Leiter meinte, wir sollten abstimmen. Nach einem Wahlgang in jedem unserer drei Autos ging es küstwärts, denn nun war auch die Neugier bei den anderen geweckt.
Es ging also ins Tsunami-Gebiet….
Fortsetzung folgt in Teil 3