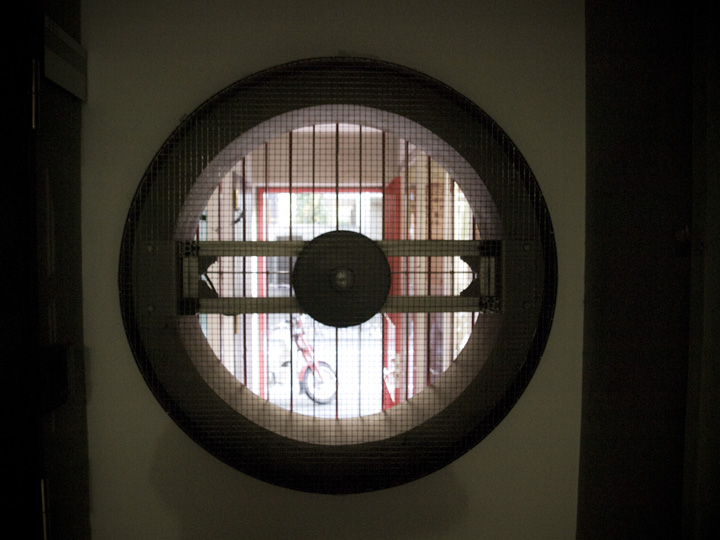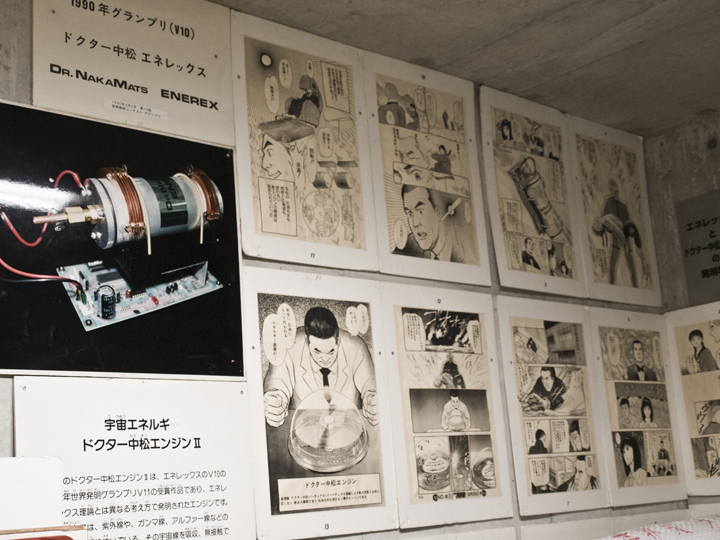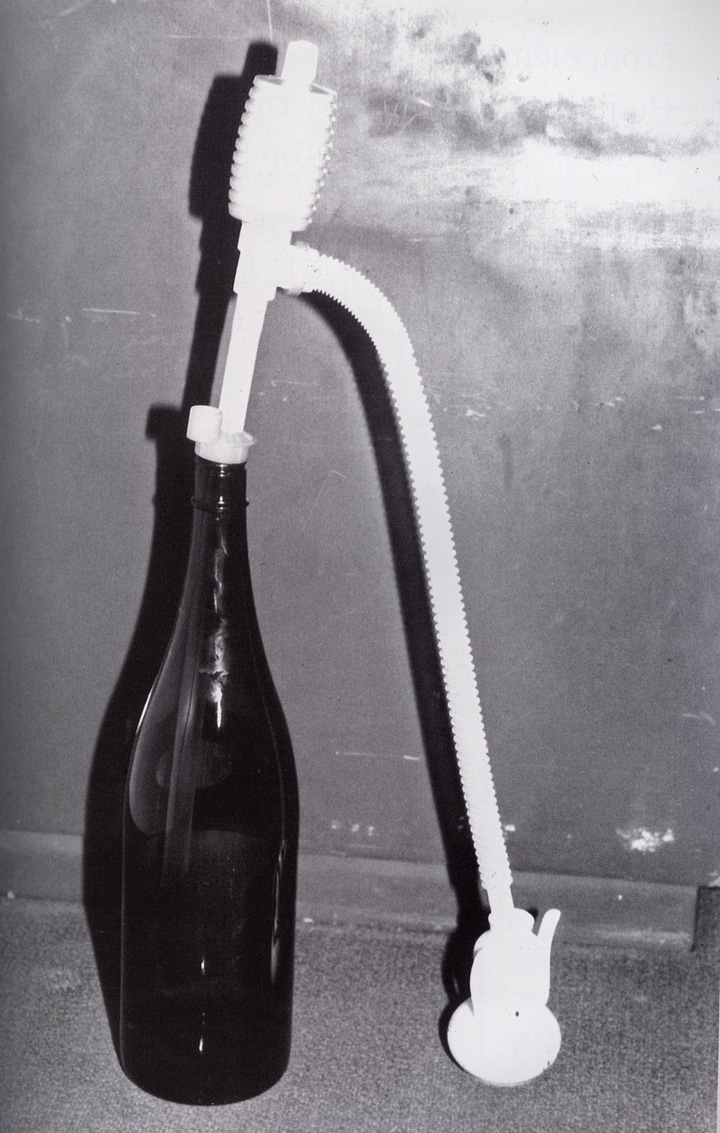Mitte Oktober war ich eine Woche lang für ein Journalismus-Projekt in Jenin, Palästina. Hier nun meine Geschichte, die auch die Geschichte der Leute ist, die ich begleitet habe und die Geschichte der Menschen, die ich dort getroffen habe. Eine Geschichte aus einer Region, aus der nicht viele Geschichten nach außen dringen, und die doch so viel zu erzählen hat.

Prolog
Eines Tages trudelte eine Email in meine Redaktion ein: Die Organisation “Global Eyes TV” macht ein Videojournalismus-Projekt in Palästina, finanziert vom Auswärtigen Amt. Zum Einen sollten wir in der nächsten Ausgabe auf dieses Projekt aufmerksam machen, zum Anderen konnten wir uns aus der Redaktion auch drauf bewerben. Ich ließ es mir ein Wochenende lang durch den Kopf gehen und bewarb mich.
Ich wusste nichts über diese Region, die Geschichte oder die aktuelle politische Lage. Ich hab den ganzen Konflikt jahrelang ausgeblendet, als er in den Medien auftauchte, weil ich ihn einfach nicht verstanden habe, und auch garnicht verstehen konnte.
Zudem konzentrierte ich mich eh immer mehr auf den Fernen als den Nahen Osten.
Gerade weil ich so wenig über die Region wusste, wollte ich hin. So konnte ich mir möglichst unvoreingenommen selbst ein Bild der Lage machen. Aber das ich mich auf das Projekt, auf eine neue Herausforderung, beworben habe, hatte auch andere Gründe:
Zu dem Zeitpunkt war ich bereits in dem dritten Monat nach meiner Landung in Berlin – und ich war in einem absoluten Tief. Der “Expat Blues” traf mich nun voll.
Expats bzw. Expatriate sind Leute, die von ihrer Firma für einige Jahre ins Ausland gehen und dort in den Zweigstellen u.a. leitende Positionen einnehmen. Nach Ablauf ihrer Expat-Zeit werden sie wieder zurück beordert – und fallen in ein Loch. Im Ausland noch in einer gehobenen Position, kommen sie wieder in den alten Trott ihrer Firma zurück. Einige brauchen Jahre um sich zu erholen.
Mir ging es ähnlich. War ich in Japan noch von allen als Fotojournalist akzeptiert und konnte so arbeiten, wurde ich in Berlin wieder in die Rolle gedrängt, die ich vor meinem Jahr in Japan hatte und aus der ich rausgewachsen war. Alle sahen mich nur als unerfahrenen jungen Fotografen, ohne Abschluss.
Meine erste Bemühungen Arbeit zu finden, als Fotoassistent oder Fotograf bei kleineren Publikationen, fruchteten nicht. Das frustrierte und ich stellte mehr und mehr die Frage, warum ich überhaupt wiedergekommen bin. Ich brauchte nur irgendwie ein Signal, ein Zeichen, oder einen kleinen Erfolg, der mir zeigt, dass meine Anwesenheit in Berlin Sinn hat. Sonst könnte ich ja gleich wieder die Koffer packen und in das Land zurückkehren, in der meine Arbeit befriedigender war.
Schlussendlich bekam ich meinen alten Job bei der Berliner Zeitung wieder, mit einem Foto pro Woche. Die ersten Wochen in diesem Job waren absolut unbefriedigend.
Nachdem ich es gewöhnt war, in Japan große Reportagen zu fotografieren, oder interessante Portraits für 200€ pro Auftrag, gab es in Berlin wenig Spannung und wenig Geld. Das liegt vlt. weniger an Berlin, als an meiner Erwartungshaltung, doch es zog mich immer weiter runter.
Dazu kam, dass ich seit Monaten (!) an einem Artikel saß und nicht weiter kam. Und bevor dieser nicht fertig wird, brauch ich mich garnicht erst an weitere Themen setzen.
Als dann auch noch Besuch aus Tokyo kam, wurde mir dieser Unterschied zwischen meinem aufregenden, hektischen und produktiven Leben in Tokyo und der Lethargie in Berlin, nur noch klarer.
Ich hatte schlichtweg meine Motivation für Fotografie verloren. Nicht nur unbedingt, weil ich kaum eine berufliche Perspektive in Berlin sah. Ich fand einfach nichts mehr spannend. Alles war fad.
Meine Bewerbung und Fahrt nach Palästina war gewissermaßen eine Flucht von all dem, was mich in Berlin frustrierte. Eine Flucht nach vorn.
“Du bist dabei!”
Ich bewarb mich also – und dann blieb es eine zeitlang still. An einem Freitag kam dann eine Email: “Wir haben kaum noch Plätze frei, wer zuerst auf diese Email antwortet, ist dabei”. Die Email kam kurz nachdem ich aufwachte, und glücklicherweise entschloss ich mich, erst die Emails zu checken und danach dann zu frühstücken.
Ein paar Stunden später kam die Bestätigung. Ich war der zweite, der auf die Email antwortete, und hatte somit noch den allerletzten Platz erwischt. Ich war dabei.
Vor der Fahrt waren noch zwei Vortreffen in Berlin angesetzt. Bis auf Eine kamen alle Teilnehmer aus der Hauptstadt.
Die Veranstalter, “Global Eyes TV”, kannte ich schon. Als ich Anfang 2009 beim Berliner Fenster gearbeitet habe, kam mir auch eine Pressemeldung von “Global Eyes TV” auf den Tisch. Global Eyes ist eine Videoplattform für junge Geschichten. Die Idee ist, dass Jugendliche in aller Welt sich eine Kamera schnappen und ihre Geschichte erzählen, fernab von den Dramatisierungen und großen Skandalen der Medien. Wenn ein Erdbeben in Haiti ist, guckt die ganze Welt drauf. Doch wie geht es Jugendlichen sonst dort? Was machen sie? Was finden sie spannend?
Das zu zeigen und eine globale Vernetzung von jugendlichen, ihren Gefühlen, Gedanken und Geschichten herzustellen – das ist die Idee von Global Eyes.

Eine Idee ist allerdings nur so gut wie ihre Umsetzung. Als ich mir damals im Zuge der Recherche ein paar Beiträge auf der Seite anschaute, fiel es mir doch schwer, einige Beiträge bis zum Ende anzuschauen. Um ein Video zu produzieren, braucht es schon ein gewisses Maß an handwerklichen Können, damit die im Video erzählte Geschichte auch verstanden wird.
Ich machte dann einen Beitrag über Global Eyes, der dann auf Sendung ging. Dann gings nach Japan und wieder zurück.
Inzwischen hatte sich bei den Videos auf der Plattform auch einiges getan. Und die Idee von dieser Palästina-Reise war eben auch, dass wir dort hinfahren, mit professioneller Unterstützung und Ausstattung, und dort Geschichten aus der Region erzählen. Wir würden so etwas über Videojournalismus lernen und die dort könnten ihre Gedanken und Geschichten mit uns teilen, die wir dann, einigermaßen ansprechend, ins Netz laden.
Alle Teilnehmer hatten einen, mehr oder wenigen, journalistischen Hintergrund, oder zumindest schon etwas Erfahrung in Print, Fernsehen, Online oder Film. Das machte es sehr angenehm, da alle zwar aus verschiedenen Ecken kamen, es aber ein allgemeines Interesse gab, Geschichten zu erzählen, und sich darüber auszutauschen. Ich fand das sehr erfrischend.
Die Treffen
Beim ersten Treffen waren alle noch nervös und größtenteils schweigsam. Stille macht mich immer unruhig und ich fang dann an zu labern, was mir auch leicht fiel, da zwei Leute aus meiner Redaktion auch dabei waren, und ich so schon jemanden bei den Treffen kannte.
Da ich die meiste Zeit am labern war, konnte ich die anderen nur durch Beobachten einschätzen. Nach einer Woche mit dieser Gruppe musste ich allerdings feststellen, dass ich mit meinen Ersteindrücken komplett daneben lag. Die, die ich für eine anstrengende Ökotussi hielt, ist mir am Ende der Reise am sympathischsten in Erinnerung geblieben. Mit der, bei der ich dachte, die ist nur still und sagt nichts, konnte ich mich am Amüsantesten unterhalten. Und die, mit der ich dachte am Besten klar zu kommen, konnte mich am Ende der Reise nicht mehr sehen.
Und ich, der bei den Vortreffen lange und viel gelabert hat, war in Palästina doch oft mehr für sich und in Gedanken versunken.
So kann der Ersteindruck täuschen.
Der Flug
Als wir Berlin verließen war es kalt.
In dicken Jacken und Mützen trafen wir uns am Flughafen und sammelten uns um unser Gepäck, in dem neben unseren Unterhosen auch Computer und Kamera-Equipment lag. Ich verzichtete auf meinen Computer, der eh schon am Ende seiner Tage war und selbst bei normaler Zimmertemperatur überhitzte. Ich hatte nur meine beiden Kameras dabei und mehr brauchte ich auch eigentlich nicht.
Im Sinne einer harmonischen Zusammenarbeit packte ich aber zusätzlich auch noch frische Kleidung ein.
Die Pässe wurden eingesammelt und die Flugtickets, die von einer Airline sponsoriert waren, wurden verteilt. Es gab kurz eine kleine Verwirrung am Schalter, da in meinem Pass eben nicht “Fritz” vorne dran steht, ich mich aber als solcher beim Projekt beworben hatte, und auch nach meiner Annahme vergessen hatte, das mal in einem Nebensatz zu erwähnen. So stand auch auf beiden Flugtickets “Fritz”, statt dem Namen im Pass.
Es begannen die ersten Pokerrunden um einen Fensterplatz im Flug nach Istanbul, von wo es in einem zweiten Flugzeug dann nach Tel Aviv gehen sollte. Mir war das relativ egal, ich war immer noch damit beschäftigt zu realisieren, wohin die Reise überhaupt gehen sollte.

Ein Ossi im Nahen Osten
Im Flugzeug saß ich dann neben einem älteren Herrn, der von Istanbul weiter nach Syrien flog. Er sprach mich auf die doch größere Gruppe Jugendliche an, mit der ich reiste. Ich erklärte kurz wer wir sind und wohin wir wollen – und er fing an zu erzählen.
Seit mehreren Jahrzehnten ist er im arabischen Raum unterwegs, schon zu DDR Zeiten war er als Ingenieur dort tätig um u.a. Zementwerke zu betreuen. Mir war bis dahin überhaupt nicht klar, dass die DDR dort aktiv war. Doch doch, sagt er, und erzählt von seinen Erfahrung in Arabien.
Ich war viel zu sehr beschäftigt, diesen spannenden Geschichten zu lauschen, als mir exakte Notizen zu machen. Nur ein paar Anekdoten konnte ich mir erhalten:
So ist zum Beispiel in Syrien mal in der Nähe seines Autos eine Bombe hochgegangen, mit mittelmäßiger Sprengkraft aber lautem Knall, und am nächsten Tag wurde er von seinen arabischen Arbeitskollegen als feige verspottet, weil er sich nach der Explosion gleich aus dem Staub gemacht hätte. So etwas waren die wohl mehr gewöhnt, als er.
Er selbst war nicht sonderlich parteitreu, er war nur treu seinem Handwerk, und da war er anscheinend so ausgezeichnet, dass ihn die Parteiführung um die halbe Welt schickte. Ab und an büchste er auch mal aus und reiste umher, aber immer so, dass es keiner mitbekam.
Er hatte ein unglaublich tiefes Verständnis vom arabischen Raum, dass er in einem sehr pragmatischen und oft, durch das hohe Alter, zynischen Tonfall erzählte, und mich so auf die nächste Woche in Palästina vorbereitete.
Neben dem arabischen Raum war er auch in Kuba zugange, und betreute dort eine Fabrik, die von der DDR geschenkt war. Von dort erzählte er mir zwei Geschichten, die mir noch besonders im Gedächtnis blieben:
Einmal war Honecker zu Gast in Kuba und besuchte den Sozialismus bei der Arbeit in eben dieser Fabrik, die mein Sitznachbar betreute. Fidel Castro war bei dem Staatsbesuch natürlich auch anwesend und besuchte mit Erich die Fabrik. Allerdings hatte Castro weniger Augen für den Sozialismus bei der Arbeit, als für eine junge, weibliche Mitarbeiterin. Castro beschäftigte sich also nur mit der jungen Dame, während Honecker etwas alleine in der Halle rumstand. Mitglieder aus Partei drängten dann meinen Sitznachbar doch mal den Erich zu beschäftigen, der könne doch hier nicht einfach rumstehen. Er zeigte Honecker dann ein paar Schalter und Hebel, bis Castro sich wieder zeigte.
Ein anderes Mal in Kuba wollte er zu einem Strand. Nicht unbedingt an einen Touri-gefüllten, sondern einen eigenen, freien Strand. Besonders hatte es ihm der Strand auf einer Insel angetan, die jedoch militärisches Sperrgebiet war und regelmäßig von Booten umkreist wurde.
Er besorgte sich ein paar Kisten Rum und fuhr zur Militärstation. Er bat um Erlaubnis auf diese Insel zu dürfen, doch die Soldaten winkten nur ab. “Ich hab da diese Flasche Rum im Kofferraum….” meinte er, und weckte die Neugier der Uniformierten. Sie ließen sich gern die Flaschen zeigen und meinten “Der Ami kommt heut schon nicht vorbei. Lass uns ein paar Flaschen hier, wir bringen dich hin. Wir müssen dich aber begleiten, okay?”. Zusammen mit den Flaschen, Soldaten und deren Gewehren setzten sie also über.
Knallende Sonne, 30°C und warme Uniformen vertragen sich nicht mit Rum. Die uniformierten Begleitpersonen waren nach wenigen Flaschen schon betrunken und schliefen am Strand ein. Mein Sitznachbar konnte zwar ein Boot steuern, aber er konnte ja schließlich nicht ohne die Soldaten wieder zurück. Er trug deren Körper nun also wieder aufs Boot und nahm ihre Kalashnikows, die den Betrunken vom Körper gefallen sind.
Nach der Landung in Istanbul bat ich ihn um seine Visitenkarte und er gab mir eine Empfehlung für eine lokale Spezialität in Palästina: gekochter ganzer Hammel. Die Augen sollen eine Delikatesse sein.
Die Vegetarierinnen in unserer Gruppe hörten das und äußerten laut ihre Ablehnung, woraufhin mein Nachbar meinte, dass sie doch mal mehr Fleisch essen sollten, wenn sie Kinder kriegen möchten.
Istanbul
Der erste Stopp. Schmiedeeiserne Bänke in der Transit-Lobby, überteuerte Duty Free Kram, viele Chinesen. Ein Mädel aus unserer Gruppe kaufte sich ein frisches Bier und kassierte böse Blicke von kopftuchtragenden Frauen.
Die Nachricht, dass uns ein Fahrer in Tel Aviv wegbricht, erreichte uns in Istanbul. Das bedeutete, dass wir in zwei Fahrten die Gruppe bewegen mussten und ein mehrstündiger Aufenthalt in Tel Aviv eingeplant wurde.
Wir gingen noch einmal unsere Aussagen für die israelischen Beamten durch, falls sie uns nach dem Grund unseres Aufenthalts ausfragten. Wir sollten auf keinen Fall lügen – aber die ganze Wahrheit auch nicht erzählen, wenn sie nicht direkt danach fragten.
Im Flieger nach Tel Aviv machte ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit Hummus.
Hummus ist ein Kichererbsenbrei, der mir in der folgenden Woche noch zum Frühstück und zum Abendessen begegnen sollte. Jeden Tag.
Ich verschenkten meinen Hummus schon im Flugzeug und sprach ein ernstes Wörtchen mit meinen Magen, worauf er sich in dieser Woche einzustellen hatte.
Tel Aviv

Flughafen Tel Aviv, der linke steile Gang Arrivals, der rechte Departures
Es war bereits Nacht als unser Flieger ungewöhnlich tief über Tel Aviv hinwegzog. Grenzgespräch, Gepäck und auf die Gruppe warten verzögerten sich, da ein Koffer fehlte und gleich großes Gewese gemacht wurde. Tel Aviv hat aber einen sehr schönen Flughafen.


Zwischen Ausgang und Wartenden befindet sich in der Halle nur eine bauchhohe Absperrung, an deren Seiten ein konstanter kleiner Wasserfall runterlief.
Als wir den Flughafen verließen, spürte ich gleich wieder den Sommer auf meiner Haut, der Deutschland schon vor einiger Zeit viel zu schnell verlassen hatte. Die Luft roch leicht salzig nach Meer und eine frische warme Brise zeigte mir, dass ich nun ganz weit weg von Berlin war. Ich grinste und stellte meinen Rucksack ab, um möglichst viel von dieser Luft an meinen Körper zu lassen.
Wir hatten einen alten VW-Bus und einen Fahrer, allerdings auch mehr als 10 Leute in der Gruppe. Ich plädierte darauf zu bleiben, schließlich war ich noch nie in Tel Aviv und die Aussicht, mal wieder bei warmer Luft aufs Meer zu schauen, hielt mich von der Autotür fern.
Wir teilten uns ohne Streit auf, packten unser gesamtes Gepäck in den alten VW-Bus und sagten dem arabischen Fahrer, dass er uns in ein paar Stunden abholen soll, wenn er den ersten Teil der Gruppe nach Palästina gebracht hatte. Er versicherte uns in der Dunkelheit “Schleichwege” zu fahren und die Grenzposten zu vermeiden. Diese Aussage und das alle Fenster im Auto mit schwarzen Tüchern verhangen war, gab mir zwar zu denken, doch in dem Moment war mir eh nach Meer und Sternenhimmel.
Und zudem saß ich ja nicht im Auto.
Einer aus unserer Gruppe geht auf ein jüdische Gymnasium in Berlin, ohne selbst jüdisch zu sein. Doch er sprach Hebräisch und kannte die Stadt. Er organisierte zwei Taxis, die uns zu einer “netten Ecke” bringen sollten, wo man das Meer sehen konnte.
Die Straße, an der uns die Taxis absetzten, lag direkt am Strand. Feiner Sand auf dem Asphalt blitzte im Kunstlicht der Laternen, doch ich sah eh nur Richtung Meer und Sternenhimmel.
In Berlin sieht man keine Sterne, wegen der Lichtbelastung und dem oft verhangenen Himmel, in Tokyo aus denselben Gründen erst recht nicht. Doch an der Küste hat man ja oft Glück. Ich bedachte in meiner Euphorie über die warme Temperatur allerdings zwei Sachen nicht:
1. Es war Nacht und da sieht das Meer nicht weil es zu dunkel ist.
2. Tel Aviv ist eine Touri-Hochburg und Party-Stadt.

Links das Meer, rechts das Licht
Das Meer rauschte jedoch und der Sand zu meinen Turnschuhen war feiner als ein Ostseestrand je hätte sein können. Wohl auch, weil unweit unserer Position ein Ungetüm mit Scheinwerfern durch den Sand fuhr und ihn in Kreisfahrten durchsiebte. Auf der Straße pusteten zwei Araber, soviel konnte man an der Sprache erkennen, mit einer Art Laubbläser den Sand vom Asphalt Richtung Strand. Für die niederen Jobs wird ein regelmäßiger Grenzübergang gestattet.
Für 10 Minuten am Strand war ich glücklich, und mit mir und der Welt zufrieden. Dann sah ich mich um.
Die “nette Ecke” war zu nachtschlafener Zeit sehr ungemütlich. Angetrunkene junge Gruppen standen auf beiden Seiten der Straße, viele knapp bekleidete Damen stelzten über den Asphalt und schauten den Autos hinterher. Und neben uns am Strand machte sich eine Jugendgruppe breit, die zu lauter Musik feierte und gröhlte. Ab und an büchste einer mal aus um halbnackt ins Meer zu rennen nur um dann wieder triumphierend zur Gruppe zurück zu kehren.
Sicherlich ein Klischee, doch denk ich an Israel, denk ich an Religion, zugeknöpfte Damen und komisch gekleidete Herren. Die Nacht in Tel Aviv… überraschte mich.
An dieser Stelle spaltete sich nun unsere Gruppe. Während unsere blonden Mädels die Neugier der Jungs der israelischen Gruppe weckten und sich zu ihnen setzten, blieben ich, unser Arabisch-Übersetzer & Cutter, und zwei weitere Jungs, der Gruppe fern. Unser Übersetzer, sonst ein sehr geselliger und unterhaltsamer Kerl, äußerte klar seine Unlust sich zur Gruppe zu setzen, und ich teilte seine Meinung. Und auch wenn er sie nicht noch klar benannte, so konnte ich mir die Gründe denken.
Zum Einen war der Alkoholspiegel unserer beiden Gruppen unterschiedlich, und ich persönlich finde solche Gespräche dann immer sehr leidlich. Zum Anderen erwartete ich die Art Gespräche, die ich in Japan so oft geführt habe. Zwar selten mit Japanern, aber fast immer mit internationalen Reisenden in Hostels: Wo kommst du her, cool, deine Sprache klingt ja ulkig, was machst du hier, cool, komm uns doch mal besuchen, blah… Small Talk in gebrochenen Englisch, mit echten Interesse oder nicht, und oft erzwungener Begeisterung für das was der andere sagt, aus Gastfreundschaft oder Unsicherheit. Ich habe diese Gespräche zu oft erlebt und die letzten sind nicht so lange her, als dass ich jetzt hier am Strand von Tel Aviv wieder Lust drauf hätte.
(Am Ende der Reise sprach ich noch mal mit einem der Mädels, die sich an diesem Strand zur israelischen Gruppe setzte. Sie erklärte mir, dass die doch was interessantes zu sagen hatten.)

Unser Übersetzer steht mit dem Knöcheln im Meer, während über ihm ein Licht leuchtet. Das ist nicht der Mond, kein Stern sondern ein Flugzeug im Landeanflug. Steht man dort nachts am Strand sieht man dieses Licht, wie es seinen Schein übers Meer bishin zum Strand zieht und immer größer zu werden scheint, bis es donnernd über einen hinwegzieht.
Wir zogen dann Richtung Stadt und ließen die Mädels zurück. Egal welche Straße wir nahmen, es wurde nicht angenehmer. Vom Dönermann, der von einem von uns 18€ für einen Döner abknöpfen wollte, über all die verstreuten Flyer auf den Boden, die für Prostituierte warben. Diese erinnerten mich übrigens stark an Tokyo, an Ecken in Shinjuku. Nur, dass die Mädchen dort immer Schulmädchen-Uniformen trugen.

In Hebräisch werden nicht nur heilige Schriften verfaßt, sondern auch Werbung für Nutten.
Wir holten uns ein Eis, versuchten Ecken zu vermeiden, die noch unangenehmer aussahen, als die, in der wir uns grad befanden, und gingen wieder zum Strand zurück. Die Mädels saßen immer noch da und waren vergnügt. Noch mindestens vier Stunden bis unser Auto kommt.
Irgendwann löste sich die israelische Gruppe auf und wir hatten unsere Mädels wieder. Gemeinsam gingen wir wieder Richtung Stadt, bis unser Übersetzer stoppte und meinte, er wird hier warten – und ich schloss mich ihm an.
Ich war einfach unruhig. Ich kannte weder Gegend, noch Gebräuche, noch Sprache. Dem Übersetzer ging es ebenso: “Selbst wenn jetzt einer auf mich zukommt, ich könnte ihm nicht erklären, dass er mich in Ruhe lassen soll.” Diese Unfähigkeit machte auch mich unruhig. Zudem lohnte es nicht, bei dieser Dunkelheit, die Stadt mit der Kamera zu entdecken. Wir suchten uns einen Straßenladen, ich kaufte mir einen Eistee und wir nahmen uns einen der vielen Tische, die vor dem beleuchteten Laden in der Nacht auf die Straße gestellt wurden. Sobald ein weiterer Gast kam, wurde ein weiterer Tisch hinzugestellt. Und es waren erstaunlich viele Gäste da, 3 Uhr in der Nacht.
Es war Shabbat, also Sabbat, heiliger Tag. Mir schien es allerdings auch ein Ausgeh-Tag zu sein, viele Lokale um uns rum waren von Jugendlichen besetzt. Allerdings blieben die unter sich und provozierten nicht die Älteren, die mit uns saßen und in der Nacht ihren Tee tranken und schwatzten. Ob es an der Hitze am Tag liegt, dass man sich zum Kaffee oder Tee in der Nacht trifft?
Eine Gruppe älterer Herren, deren graues Haar deutlich auf ihrer braunen Haut selbst in dieser Dunkelheit zu sehen war, spielte laut neben uns Karten.
Ich versuchte nur, wieder zur Ruhe zu kommen und holte meine Kamera raus, um das Leben um uns herum einzufangen.
…und hätte meine Kamera nicht meinen Film gefressen, wäre an dieser Stelle auch ein Bild.
So saßen wir also hier in Tel Aviv, unbekannt und stumm.
Ich habe immer versucht, nicht so raushängen zu lassen, dass wir Deutsch sind. Wer weiß ob ein angetrunkener Idiot mit Holocaust-Verbindung nicht ein Ventil für seinen Frust suchte – und das Ventil sollte nicht mein Gesicht sein.
Das funktionierte ganz gut. Die Jugendgruppe am Strand fand zwar raus, dass wir aus Deutschland kamen, allerdings hörten die auch deutsche Musik aus ihren Boxen, da ging das in Ordnung. Im Straßenlokal, als zahlende Gäste, war der Empfang ähnlich herzlich.
Eine rüstige Dame mit breiter Hüfte und 40-50 Jahren kehrte neben uns die Kippen der Kartenspieler weg und fragte uns, woher wir kamen.
“Where you from? America? I love you!”
“We’re from germany” korrigierte der Übersetzer
“From Germany? I love you!”
Irgendwann, als der Morgen langsam graute und das Schwarz hinter den Hotelhochhäusern der Stadt langsam zum Blau wurde, kam der Rest unserer Gruppe wieder zurück, unser Israel-Experte mit einem Schawarma in der Hand. Er hatte ihn gekauft, doch es war zuviel für ihn und er dachte “vielleicht hat Fritz ja noch Hunger”. Nette Geste, aber mein Magen diskutierte noch mit mir und dem Hummus über die arabische Küche, und verweigerte erstmal alles.
Seit nunmehr 5 Stunden waren wir in der Tel Aviver Nacht unterwegs und unruhig. Auf Drängen vom Übersetzer wurde nochmal der Fahrer angerufen. Er sei auf dem Weg und wir sollten uns an einem bestimmten Ort treffen, in der Nähe der amerikanischen Botschaft.
Nun mit Hebräisch-Kenntnissen im Team fragten wir uns durch. Es wurde immer heller und ich konnte nun auch wieder Bilder machen.

Palmen!
Die Straßenleuchten waren noch an, doch mehr Meer war jetzt schon zu sehen. Wir gingen zur Botschaft, dann von dort um die Ecke, dann hinter ein Haus und dann waren wir wieder an der großen Straße beim Strand, wo uns das Taxi ein paar Stunden zuvor hinbrachte. Aber diese große, unübersehbare Straße als Treffpunkt auszumachen, wäre natürlich viel zu simpel gewesen.
Auf dem Weg zum Auto kamen wir an vielen leeren Schuhen vorbei.

Tatsächlich leere Schuhe, immer in Paaren standen sie am Straßenrand. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Vielleicht haben sich ein paar angeheiterte Gesellen der Schuhe entledigt um barfuß zum Strand zu gehen – und dann wurden sie einfach vergessen. Doch so viele Paare, die an der Straße standen, das musste einen Zusammenhang haben.
Der selbe alte VW Bus lud uns wieder ein. Scheinbar hatte er es über die Grenze geschafft, und wieder zurück.
Kurz nach der Abfahrt schlief bereits die Hälfte der Gruppe ein. Ich konnte nicht, ich war viel zu aufgeregt von all den Eindrücken und hatte auf der Straße nach Palästina stets die Kamera im Anschlag. Bei solch einem intensiven Sonnenaufgang auch verständlich.



Auf der Straße waren wenig Autos, dafür Radfahrer, Fußgänger und auch ganze Schafsherden.
Das Auto hatte seine besten Tage schon hinter sich, die meisten Gummierungen und Polster waren abgerissen oder lose. Einen Gurt gab es nur für den Fahrer und Beifahrer.

Aus den Boxen tönte der schlechteste Musikmix, den ich seit Jahren gehört hatte, über den ich mich konstant auch bei jedem neuen Pop-Fehlgriff laut beschwerte. Es war nichtmal arabische Musik, sondern US-Songs aus den 70er und 80ern, einige schlecht gecovert, abgespielt von einem alten Tape, dessen Band schon zu oft durch das Gerät gequält wurde.
Wir fuhren vorbei an Siedlungen, eingemauert und eingezäunt, oder komplett frei. Der Blick aus dem Fenster erzählte viel, auch wenn nicht mehr alle wach genug waren, hinzusehen und zuzuhören.

Je weiter wir uns von Tel Aviv entfernten, desto karger wurde das Land. Hügel, mit Geröll, Gestein und Gewächs, die mich an die mediteranen Landschaften von Italien erinnerten. Und das war das heilige Land? Hügel voller Felsen?

Nebenbei bereitete ich mich auf den Grenzübergang vor. Viel hatte ich gehört, von intensiven Befragungen und Durchsuchungen, mit vorgehaltener Waffe oder ohne. Israel ist streng, was die Ein- und Ausreise in die besetzten Gebiete angeht. Wir fuhren auf den Grenzposten zu und ich packte die Kamera nach dem Foto weg.

Um die Zeit war der Grenzposten seltsam leer. Je näher wir kamen, desto weniger sahen wir. Aus den Boxen spielte “Knocking on Heavens Door” von einem oftkopierten und abgespielten alten Tape, während wir über die Grenze fuhren.
Und dann… waren wir durch.
Es war niemand da! Kein Mensch kontrollierte uns oder kümmerte sich überhaupt darum, wohin wir wollten. Nach all dem Gerede und Panikmache im Vorfeld sind wir einfach durchgefahren. Ich fing an laut zu lachen.
Mein noch wacher Nachbar guckte mich leicht schockiert an, dass ich aus unerfindlichen Gründen anfing herzhaft zu lachen, doch ich fand das alles einfach nur absurd.
Eine aus unserer Gruppe wachte durch mein Lachen auf und fragte, ob sie den Pass für die Grenze rausholen sollte. Ich lachte nur weiter und winkte ab.

Wir waren nun in Palästina und folgten der Straße Richtung Jenin, dem Ort, in dem wir die nächsten Tage leben werden. Das Land wurde immer karger, die Gebäude provisorischer und abgeranzter. An den Straßen fanden sich erstaunlich viele Autowerkstätten. Zumindest die werden oft gebraucht hier.

Wir fuhren vorbei an leeren Hügeln und aufgegebenen Siedlungen. Fast alle Gebäude umwehte der Hauch des Temporären, als wäre hier nichts für Dauer gebaut und könnte so schnell abgerissen werden, wie es hingebaut wurde.

An den höchsten Gebäuden konnte man den vorherschenden Glauben der Siedlung erkennen. Minarette und Kirchtürme (von denen gab es allerdings weniger) stachen an den Hügeln hervor. Unser Fahrer erzählte von Siedlungen, wie der christlichen Siedlung auf einem Hügel links und eine moslemische Siedlung auf einem Hügel rechts. Zwischen ihnen nur das Tal, die Straße und Harmonie. Die, die in dieser Region Stress machen, sind andere…
Durch den Hügel durch ergab sich dann ein Blick ins weite Tal.

Hier und da mal ein Feld, von denen einige an diesem Morgen dampften. Wir fragten unseren Übersetzer, der die ganze Zeit den Fahrer dolmetschte, wie weit der Weg noch ist, doch bevor dieser wieder übersetzen konnte, antwortete der Fahrer auf Deutsch “Sechsundzwanzig Kilometer”. Wir konnten nur erstaunt sagen “ah Deutsch?” und er sagte “Warum nicht?”. Er hat wohl einen Verwandten in Deutschland und hat ein paar Sachen aufgeschnappt.
Dass er meine ständige Kritik an seiner Musik wohl die ganze Zeit gehört haben musste, wurde mir dann schlagartig klar. Aus Höflichkeit wird er wohl nichts gesagt haben, mutmaßt unser Übersetzer.

De Fahrer fragte: “Wollt ihr mal Kamele sehen?” und ich zückte schon die Kamera. Wir fuhren an einer Kamelfarm vorbei…


…und ein Vorurteil erfüllte sich. Auch wenn ich keine Kamele in freie Wildbahn oder in der Wüste gesehen habe – so etwas gibt es auch nicht mehr. Genauso wenig wie es in Europa Pferde oder Kühe in freier Wildbahn gibt.
Nicht mehr lange nach der Kamelfarm hielten wir an und es hieß, wir sind da. Inzwischen war es 8 Uhr morgens, der Betrieb auf den Straßen im Ort im vollen Gange. Die Sonne knallte hell und wir verdrückten uns ins Hostel. Wir weckten zwar die, die mit der ersten Fuhre ankamen, doch das war uns egal. Naja, mir zumindest.

Ich war nicht müde. Draußen war es taghell. Die Hähne schrien die Morgensonne an und die Martkschreier ihre Kunden. Autos hupten wild und immerwieder hörte man die Hühner. Hupen und Hühner, das war mein erster Eindruck von Jenin.
Ich legte mich in Klamotten aufs Bett und war nicht müde. Oder anders: Ich konnte nicht schlafen. Soviele Eindrücke prasselten in den letzten Stunden auf mich ein, mein Gehirn hatte noch garnicht alles verarbeitet. Müde schrieb ich alles auf, was mir aus den letzten Stunden im Gedächtnis blieb. Ich schloss meine Augen, um sie kurz auszuruhen.
Vier Stunden später wachte ich in Klamotten auf, der erste Projekttag stand an und das erste Treffen war in 20min. Ich spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht und machte mich auf dem Weg. Angezogen war ich ja schon, das sparte Zeit…
———
Post aus Nah-Ost:
Teil 1 – Die Straße nach Palästina
Teil 2 – Wie Tag und Nacht
Teil 3 – Der Tag der kaputten Kameras
Teil 4 – Männer müssen draußen bleiben